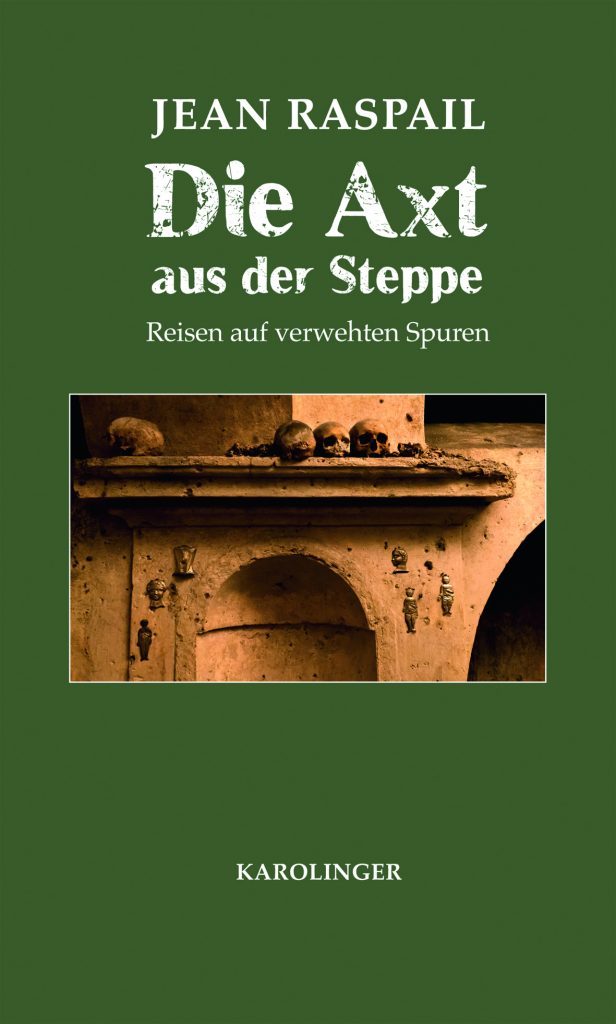Er habe eine Vorliebe für ironisches Pathos, bekennt Jean Raspail, während er den Hingang verschiedener indigener Völker und traditioneller ethnischer und religiöser Verbände beschreibt. Ohne Wehmut kommt ein Zeuge solchen Verschwindens natürlich nicht davon. Gerade dieser Tonfall, der sound, macht die literarischen Reportagen des französischen Romanciers mit dem Titel „Die Axt aus der Steppe“ so lesenswert.
Anhand des Mythos von der Weitergabe der Axt von einer Generation zur nächsten arbeitet Raspail die gravierenden Unterschiede zwischen den Menschenmassen der Gegenwart und dem wahren Mensch-Sein mythologisch gebundener Kleingruppen heraus. Er als Romantiker bezeichne vergessene Minderheiten als „verlorene Völker“ oder „Zeugen-Völker“:
„Zeugen der Vergangenheit, gewiß, aber in erster Linie des Fortbestehens der Vergangenheit und seines unschätzbaren Weiterlebens bis in unsere Tage. Es hat den Anschein, daß diese aufgrund ihres tragischen Minderheitendaseins von der Außenwelt abgekapselten Völker gerade daraus die Kraft geschöpft haben, sich selbst treu zu sein und da oder dort auf der Erdoberfläche stehen zu bleiben, wie die Pflöcke – oder Zeugen – einer historischen Landvermessung. Oder daß sie einander wie Staffelläufer als Zeugen den Stab weitergereicht haben…“.
Der Schriftsteller beschreibt seine Suche nach der Seele hinter der teilweise abstoßenden Hülle, nach den „wohlgeborenen Seelen“ derer, die für ihn allein die Bezeichnung Mensch verdienen, weil sie die Bande zwischen den Lebenden und Toten aufrecht erhalten. Und weil sie „das Essenzielle“ verkörpern: den Glauben und die Sehnsucht nach dem Heiligen.
Um die Axt aus der Steppe weitergeben zu können, bedarf es mitunter delikater Vermittler von außerhalb: der Ethnologie, der Kunst und – bei aller Ambivalenz – des Tourismus. Man verdanke die Bewahrung der Vergangenheit oftmals sanften, manischen Sturschädeln, die sich aus der Ferne in etwas verlieben und es detektivisch erkunden, obwohl es ihnen fremd und nutzlos ist. Diese sind für den Dichter ebenfalls Menschen.
Traurig machten auf Abwege geratene Stammesreliquien: Hostienkelche, Äxte, Totempfähle, „die in den Händen von Aasgeiern, die sich an der Vergangenheit weiden, mit einem Mal seelenlos und tot erscheinen.“
Raspail beklagt, daß für die meisten von uns die Kette – der Ariadnefaden – schon auf dem vorherigen Glied verschwindet. Der kleine Mann von heute weiß nur noch, wie er heißt und von wem er unmittelbar abstammt. Er steht allein im Mittelpunkt seines vergänglichen Lebens, zwischen seinem Vater und seinem Sohn, den äußersten Marksteinen seiner Existenz. Die Wüste ist nah und grenzenlos.
„Vom Begriff der Zeit hat er nur eine horizontale Wahrnehmung, etwas geradezu lächerlich Beschränktes. In der fortwährenden Eruption von Menschen an die Erdoberfläche, findet er sich mit Milliarden anderen zusammengedrängt, sein tatsächliches Universum aber ist auf seine unmittelbaren Nachbarn beschränkt. Für die vertikale Wahrnehmung, jene, die auf der Leiter der Vergangenheit aufsteigt – bis hin zu Gott, warum nicht? – und die ihm seinen Adel zurückgeben würde, so bescheiden seine Abstammung auch sein mag, hat er kein Bewußtsein. Oft weist er sie sogar zurück. Wenn er dieses Gepäck los ist, glaubt er schneller zu laufen! Er galoppiert im Kreis, der kleine Mann, wie ein Gaul am Ende einer Longe, angepflockt an seiner Anonymität.“
Raspail ist überzeugt davon, daß die Kette lange intakt geblieben ist und erst bei Anbruch der modernen Zeiten brüchig zu werden begann, als die Menschen sich vom Wahrhaftigen entfernten, „um sich einem Haufen Unsinn zu widmen.“ Das Ergebnis sind Leben, die von Zufällen bestimmt werden: es gibt nichts, das sie stützt und das ihnen eine Daseinsberechtigung oder einen Sinn geben würde. Der moderne Mensch hat weder eine Vergangenheit noch eine Schöpfungsgeschichte.
„Es verlangt ihn nicht danach, er sieht keine Notwendigkeit dafür. Er findet Gefallen an der Abwesenheit von Mythen. Er genügt sich selbst. Keine Tempel auf den Gipfeln, keine Opfersteine am Ufer der Seen, keine heiligen Städte, keine Hohepriester, keine Königsgräber, keine Eingeweihten, keine rätselhaften Ruinen, welche das Aufeinanderfolgen mystischen Strebens zum Göttlichen belegen würden. Nichts, was ihn über das Alltägliche hinaushebt. Ein Mensch in aller Seelenruhe. Man wäre versucht zu ergänzen: in aller Seelenlosigkeit.“
Der designierte Reaktionär berichtet vom Gespräch mit einer Frau, die vorgab, keine Zeit zu haben um ihm zuzuhören. Sie lehnte die entfremdete Vergangenheit und die Sklaverei der Traditionen ab und projizierte sich im Wesentlichen auf die befreiende Gegenwart. „Zeitgeistiges Gerede!“ urteilt Raspail und überläßt solcherart trostlose Existenzen ihrem Nichts.
Auch an den christlichen Kirchen läßt Raspail kein gutes Haar. Immer hätten die christlichen Missionare die Eingeborenenvölker von ihren Wurzeln abgeschnitten. Und er outet sich als elitärer, erzkonservativer Katholik, wenn er bekennt, er sei „römisch-katholisch, vorkonziliar, voller Abscheu gegenüber dem deistischen und sozialen Brei der Ökumene, der schlimmsten Häresie unserer Tage, die uns von der dominierenden Strömung aufgezwungen wird… Die Minderheit macht den Glauben, von der Masse wird er entwürdigt.“ Der moderne Katholizismus – also schon der nachkonziliare – habe den Glauben weggezaubert. Es gäbe nur noch eine allgemeine, „irgendwie noch monotheistische Kotze“, die uns überfluten wird.
Gegen die schwachsinnige Vergöttlichung des Menschen setzt Raspail das Fortleben traditionell lebender Verbände, die Vornehmheit des Beharrens. Damit auf verlorenem Posten zu stehen, nimmt er gelassen hin: „Gesellschaft hat man dort selten. Alle anderen kehren uns den Rücken. Sie haben kein Gesicht mehr. Die Menschen sind tot. Die sie ersetzen, entsetzen uns.“ Wir sprechen ihre Sprache nicht.
Literatur:
Jean Raspail, Die Axt aus der Steppe. Reisen auf verwehten Spuren, Karolinger, Wien/Leipzig 2019. Hier erhältlich.